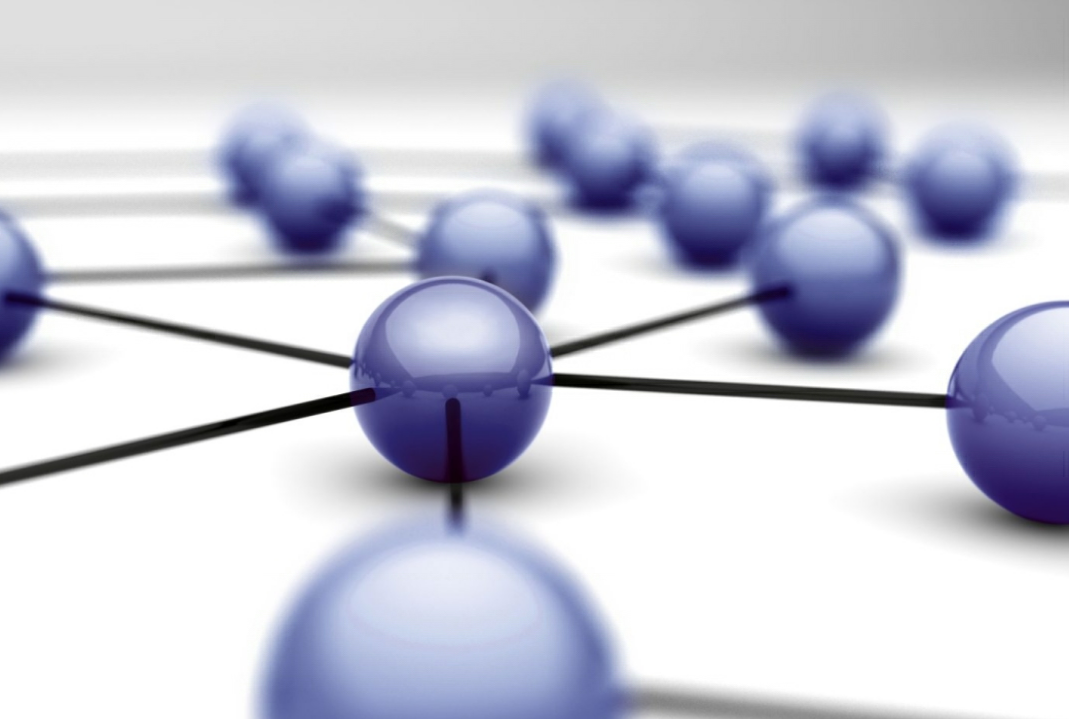Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen und der Digitalisierung nimmt der QuMiK-Klinikverbund (Qualität und Management im Krankenhaus) in Baden-Württemberg Stellung zu verschiedenen gesundheitspolitischen Themen und zu künftigen Entwicklungen durch digitale Neuerungen. Der Verbund fordert konkrete Unterstützung von der Politik und eine angemessene Ausgestaltung der Krankenhausreform mit einer bedarfsgerechten Krankenhausstrukturplanung und Finanzierung.
Im Zentrum der Diskussionen stehen die Themen Finanz- und Versorgungsmisere der Krankenhäuser, Krankenhausreform sowie Digitalisierung im Krankenhausbereich und Chancen durch Künstliche Intelligenz (KI).
„Schwerpunkt der diesjährigen QuMiK-Pressekonferenz ist ein weiteres Mal die Krankenhaus-Politik, notgedrungen, weil alle Geschäftsführer im QuMiK-Verbund im laufenden Jahr von stark steigenden Defiziten betroffen sind und die Existenz vieler Krankenhäuser mittlerweile massiv gefährdet ist“, konstatiert Matthias Ziegler, Geschäftsführer des Klinikums Esslingen.
"Die Kliniken in Baden-Württemberg bringen seit Jahren bei Bettenzahlen, Fallzahlen und Krankenhauskosten enorme Anstrengungen auf. Die finanzielle Lage verschärft sich aber weiter und ist mittlerweile existenzgefährdend, erläutert Christoph Rieß, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb." „Die Kliniken müssen seit Jahren aus wirtschaftlichen Gründen viele Leistungen anbieten, um die gesetzlich geforderte Vorhaltung zu refinanzieren.“
„Wir brauchen jetzt eine Krankenhausreform, die Leistungsgruppen zuordnet, dann aber auch die notwendige Vorhaltung und die notwendige Transformation finanziert – sowie die nicht bezahlten Kostensteigerungen durch Inflation“, fordert Rieß.
„Die Krankenhäuser sehen durchaus die Notwendigkeit einer Reform“, so Wolfgang Schmid, Kaufmännischer Geschäftsführer des Alb Fils Klinikums in Göppingen, „jedoch muss diese auskömmlich finanziert werden und eine flächendeckende Versorgung von Patienten weiterhin gewährleistet sein.“ Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt davor, dass allein in diesem Jahr bis zu 80 Kliniken von Insolvenz bedroht sein könnten und dass es bereits ohne Reform Schließungen von Kliniken geben wird, ist vorgezeichnet. „Die Finanzlage der meisten Krankenhäuser ist äußerst kritisch und die Finanzierung der Krankenhausreform Stand heute noch völlig unklar“, so Schmid weiter, „ein Transformationsfond ist notwendig und die vollständige Finanzierung – vor allem auch der Inflationslücken der Jahre 2022 und 2023 – unbedingt notwendig, dies wird aber derzeit nicht erfüllt.“
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Vorhaltevergütung „diese führt bei gleichbleibender Leistung zu keiner finanziellen Verbesserung“, so Schmid. „Die Einhaltung von Qualitätskriterien ist entscheidend für Vorhaltefinanzierung“. Baden-Württemberg will neben NRW Vorreiter bei Umsetzung der Leistungsgruppen sein, und dies unabhängig vom Beschluss des Bundesgesetzes. Die Einführung von 60 Leistungsgruppen analog NRW soll noch um fünf zusätzliche Leistungsgruppen ergänzt werden. Dass sich die Krankenhauslandschaft verändert und verändern muss, ist auch durch die zunehmende Ambulantisierung und hybride Abrechnungsmodelle begründet. Außerdem macht sich im Gesundheitswesen der Fachkräftemangel wie in keiner anderen Branche bemerkbar. „In Zukunft steht nicht mehr genug Personal zur Verfügung, um so viele Kliniken wie bisher auf einem guten qualitativen Niveau betreiben zu können“, so Schmid, „wir haben heute schon ein eklatantes Personalproblem, eine Entbürokratisierung ist nicht in Sicht und diese bindet wertvolle Personalressourcen.“
„Wenn wir über Digitalisierung im Krankenhauswesen sprechen, dann reden wir über eine der zentralen Fragen der Zukunft – die langfristige Leistungsfähigkeit der Kliniken und somit auch die Qualität der Patientenversorgung hängen ganz maßgeblich davon ab, wie schnell, umfassend und patientenorientiert die Digitalisierung umgesetzt wird“, erläutert Thomas Weber, Geschäftsführer der SLK-Kliniken Heilbronn. „Das Hauptproblem auf dem Weg zur Digitalisierung liegt im Bereich der Finanzierung – diese ist bisher nicht ausreichend gegeben. So bremst beispielsweise die im Rahmen der Krankenhausreform angedachte Vorhaltefinanzierung die Digitalisierung eher aus, da diese keine finanziellen Mittel dafür bereithält – und über den verbleibenden DRG-Anteil können die bereits laufenden Kosten, Stichwort Krankenhauszukunftsgesetz, ebenfalls nicht gedeckt werden.“
„Die Bereitschaft – gerade innerhalb des QuMiK-Verbundes – zur Digitalisierung ist sehr hoch. Sie ist eine immense Chance – sowohl für Patienten als auch für die Mitarbeitenden in den Häusern. Sofern die finanziellen Weichen seitens der Politik richtig gestellt werden, kann die Digitalisierung einerseits ein Hebel sein, die Mitarbeitenden zu entlasten und somit auch dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegen wirken zu können. Andererseits bietet sie enormes Potenzial für die Patienten und kann auch dafür sorgen, den Zugang zu einer standortunabhängigen Medizin auf Spitzenniveau deutlich zu verbessern“, bemerkt Weber.
„KI wird in den nächsten Jahren die Medizin revolutionieren und zunehmend eingesetzt, um diagnostische Prozesse zu verbessern, Behandlungspläne zu optimieren und patientenspezifische Daten zu analysieren. Beispiele sind maschinelles Lernen, Bilderkennung in der Radiologie und personalisierte Medizin durch Analyse von Genomdaten“, betont Prof. Dr. Jörg Martin, Geschäftsführer der RKH Gesundheit. „KI-Algorithmen können medizinische Bilder wie Röntgenaufnahmen, CT-Scans und MRTs analysieren, aber auch in der Anamnese eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel ist der Einsatz eines KI-basierten Diagnose-Checkers beim Projekt RKH Care. Dank einer hochmodernen KI-basierten Software der Leipziger Firma DOCYET erhalten Hilfesuchende nach mehreren Fragen zur Person und zu den akuten, individuellen Beschwerden eine erste Einschätzung zu ihrer Erkrankung und der Dringlichkeit sowie einen Vorschlag für einen geeigneten Behandlungspartner.“
„KI hilft bei der Optimierung von Medikationsplänen, indem sie Wechselwirkungen und optimale Dosierungen basierend auf Patientendaten vorschlägt. KI ist ein wichtiger Schritt zur individualisierten Präzisionsmedizin. Der Arzt wird weiter gebraucht, bekommt aber eine andere Rolle“, führt Martin aus.